Sinnvoll regulieren – jenseits von Verbot und Verharmlosung
Der Konsum psychoaktiver Substanzen und Aktivitäten mit hohem Suchtpotenzial birgt Risiken für Einzelne und die Gesellschaft. Darum greift der Staat regulierend ein. Aber oft ist die Regulierung historisch gewachsen und nicht wissenschaftlich fundiert. Das führt zu Über- oder Unterregulierungen mit unerwünschten Folgen – wie einem florierenden Schwarzmarkt oder verharmlostem Konsum.
Wir setzen uns für eine differenzierte, ausgewogene Regulierung ein, um sowohl den Schutz der Bevölkerung als auch einen verantwortungsvollen Umgang durch die Konsument:innen zu stärken.
Dies sind unsere fünf zentralen Prinzipien für eine sinnvolle Regulierung:
Risiko jedes Produkts realistisch einschätzen

Jede Substanz birgt unterschiedliche gesundheitliche, soziale und finanzielle Risiken. Diese unterschiedlichen Risikoprofile erfordern eine unterschiedliche Herangehensweise bei der Regulierung.
Jedes Produkt individuell regulieren

Es gibt keine Einheitslösung für alle psychoaktiven Produkte. Regulierung muss differenziert erfolgen, sich an die spezifischen Risiken jedes Produkts anpassen und verschiedene Regulierungsinstrumente wie Herstellung, Verkauf, Marketing, Preisgestaltung und Besteuerung gezielt kombinieren.
Keine pauschalen Verbote – Schwarzmarkt vermeiden

Produkte mit hohem Sucht- und Gefährdungspotenzial einfach zu verbieten, mag auf den ersten Blick logisch klingen. Doch generelle Verbote führen immer zu einem florierenden Schwarzmarkt, der Konsument:innen gefährdet und hohe soziale und finanzielle Kosten verursacht.
Die Erfahrung zeigt: Produkte wie Cannabis und Kokain sind trotz Verbot leicht verfügbar – auch für Minderjährige. Die strenge Regulierung verursacht hohe Kosten für Polizei und Justiz, ohne dass dies den Konsum einschränkt.
Legalisierte Produkte nicht verharmlosen

Alkohol und Nikotin sind Paradebeispiele für unzureichend regulierte Substanzen: Beide weisen ein hohes Abhängigkeitspotenzial sowie ein beträchtliches Schadensrisiko für Konsumierende, ihr Umfeld und die Gesellschaft insgesamt auf. Trotzdem sind sie überall leicht erhältlich und unterliegen keinen strengen Werbebeschränkungen.
Wissenschaft als Kompass einsetzen
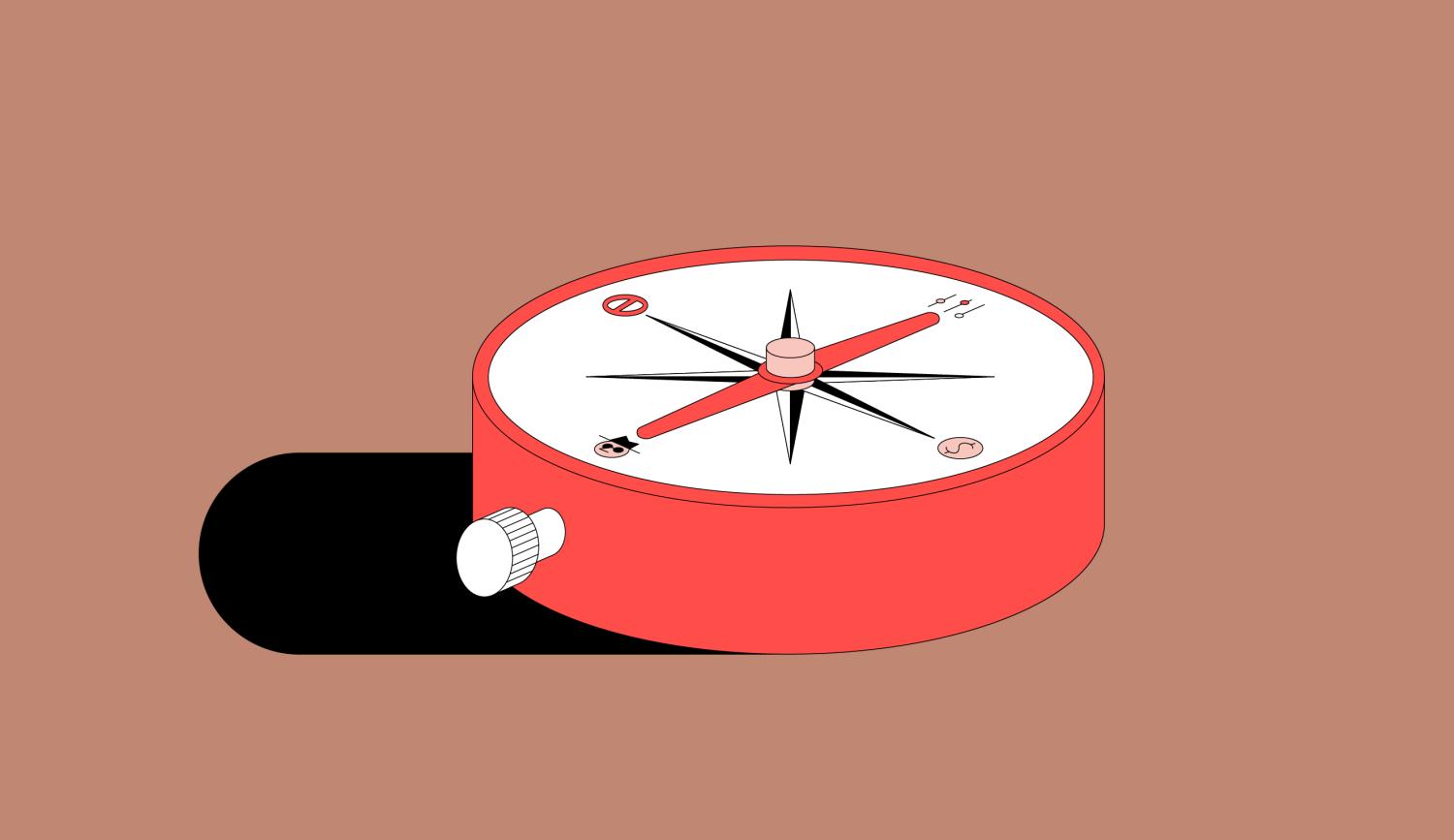
Regulierungen müssen auf fundierter Forschung und Pilotprojekten basieren. Nur so lassen sich wirksame und angemessene Massnahmen entwickeln und an neue Erkenntnisse anpassen. Die Arud engagiert sich aktiv in wissenschaftlichen Studien zur Cannabisregulierung und ist Partnerin der schweizweit grössten Cannabis-Studie «Swiss Cannabis Research-Zürich».
Regulatorische Anpassungen sind dringend nötig!
Viele Regulierungen sind historisch gewachsen, politisch oder wirtschaftlich motiviert – und nicht wissenschaftlich fundiert. Auf diese Schieflage weisen wir seit Jahren hin, denn sie führt zu Über- oder Unterregulierungen.
Anpassungen sind nötig – und sie sollten zuerst dort ansetzen, wo der Konsum weit verbreitet ist oder die bestehenden Regulierungen am wenigsten nachvollziehbar sind.
Alle Illustrationen ©Benjamin Hermann
Das Poster zum Jahresrückblick 2024

Das Poster zum Jahresrückblick 2024 zeigt, wie eine ausgewogene Regulierung von Suchtmitteln und Verhaltenssüchten gelingt.
Sie finden unsere Arbeit grossartig?
Wir freuen uns über Ihre Unterstützung, denn nicht alle Engagements der Arud können über die Krankenversicherung abgerechnet werden und so sind wir für besondere Angebote und Pionier-Projekte auf Spender:innen angewiesen. Gemeinsam sind wir stärker! Erfahren Sie hier, wie Sie die Arud unterstützen können.